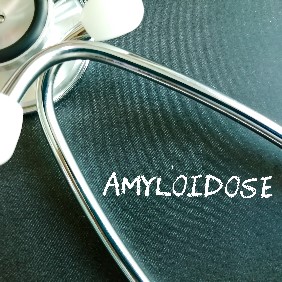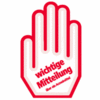Die ATTRv-Amyloidose ist eine seltene, aber gravierende Erkrankung, die häufig nicht erkannt wird. Sie tritt auf, wenn das in der Leber gebildete und dem Transport von Thyroxin und Retinol dienende Protein Transthyretin (TTR) in Monomere zerfällt, die sich sodann in Form von Amyloidfibrillen im Körper ablagern und Organe sowie Gewebe schädigen. Die Krankheit kann viele verschiedene Symptome verursachen, die von Patient zu Patient variieren und auch davon abhängen, welche Organe (Herz, Nieren und/oder Nervensystem) betroffen sind.
Zu beachten ist außerdem, dass sich die ATTRv-Amyloidose spät – oft erst nach dem 50. oder 60. Lebensjahr - manifestieren kann.
Als besonders problematisch ist aufgrund der inzwischen verfügbaren Therapien die meist verspätete Diagnosestellung anzusehen, da klinische Zusammenhänge mit anderen Organsystemen häufig übersehen werden. Die wichtigste Fehldiagnose ist hierbei die chronisch inflammatorische Polyneuropathie (CIDP). Eine ATTRv-Amyloidose ist spätestens dann in Betracht zu ziehen, wenn die Therapie der CIDP keinen Effekt zeigt.
Charakteristisch für die ATTRv-Amyloidose sind bestimmte Leitsymptome wie z.B. aus neurologischer Sicht eine
- rasch progrediente symmetrische sensorisch-motorische Neuropathie
- Manifestation mit kribbelnd-brennenden Parästhesien an Füßen und Händen, Taubheitsgefühlen und im Verlauf distale Paresen
sowie kardiologisch
- Herzinsuffizienz mit normaler/erhaltener Pumpfunktion ohne Bluthochdruck (insbesondere bei Männern)
- Manifestation mit u.a. geminderter körperlicher Belastbarkeit und Luftnot
- Hypotonie bei Personen mit früherer Hypertonie
- Ödeme der unteren Extremitäten
Tritt zu einem solchen kardiologischen und/oder neurologischen Leitsymptom mindestens einer der folgenden „Red Flags“ hinzu, sollte eine mögliche ATTRv-Amyloidose in Betracht gezogen werden:
- Nephrotisches Syndrom (Proteinurie oder Nierenversagen/-insuffizienz) ohne Diabetes mellitus oder andere offensichtliche Ursachen
- Bilaterales (!) Karpaltunnelsyndrom (bei ca. 60% der ATTRv-Patienten)
- Gastrointestinale Beschwerden (z.B. chronischer Durchfall, Verstopfung/Durchfall)
- Unerklärliche Gewichtsabnahme
- Frühe autonome Dysfunktion (z.B. erektile Dysfunktion oder orthostatische Hypotonie)
- Glaskörpertrübungen
- Familiengeschichte mit ATTRv-Amyloidose
Um eine Symptomkombination im Rahmen der Anamneseerhebung in Erfahrung bringen zu können, empfehlen sich folgende Fragen:
- Fallen Ihnen sportliche Aktivitäten und/oder bloßes Treppensteigen zunehmend schwerer und geraten Sie unter Belastung in Atemnot?
- Leiden Sie oft unter geschwollenen Beinen?
- Sind Sie in kardiologischer/neurologischer/gastroenterologischer Behandlung?
- Haben Sie einen zu niedrigen Blutdruck bzw. wird Ihnen beim Aufstehen manchmal schwindelig, obwohl Sie früher unter Bluthochdruck gelitten haben?
- Haben Sie häufig Durchfall/Verstopfung oder ist Ihr Gewicht in letzter Zeit ohne erkennbaren Grund stark zurückgegangen?
- Haben Sie Potenzprobleme?
- Leiden Sie unter Schmerzen/Taubheitsgefühl/Schwäche in den Füßen und Händen?
- Kennen Sie im Familienkreis einen Angehörigen mit ATTRv-Amyloidose oder einer Polyneuropathie?
Liegt ein Leitsymptom in Kombination mit mindestens einer der „Red Flags“ vor, empfiehlt sich – neben einer gastrointestinalen und ophtalmologischen Abklärung - folgendes diagnostisches Vorgehen:
Neurologisch: Elektroneurografie (ENG), Elektromyografie (EMG), Quantitative sensorische Testung (QST)
Kardiologisch: EKG, Echokardiografie, kardiale Biomarker, Knochenszintigrafie, Kardio-MRT
Erhärten diese Untersuchungen den Verdacht einer ATTRv-Amyloidose, sollte zur Bestätigung der Diagnose eine molekulargenetische Untersuchung des TTR-Gens veranlasst werden. Die für die ATTRv-Amyloidose charakteristischen Amyloid-Ablagerungen lassen sich zwar auch mittels Biopsie in geschädigten Geweben nachweisen; ein Gentest ermöglicht aber darüber hinaus auch eine Unterscheidung dahingehend, ob eine sog. Wildtyp-Amyloidose oder aber eine hereditäre ATTR vorliegt, was unterschiedliche Therapieoptionen eröffnet.
Eine frühzeitige Diagnose gewährleistet die bestmögliche Therapie. Zwar ist die ATTRv-Amyloidose aktuell noch nicht heilbar, aber es ist möglich, die Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, so dass sich beispielsweise eine bei schweren Verläufen drohende Leber- oder Herztransplantation verhindern oder zumindest lange herauszögern lassen.
Folgende medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten stehen aktuell zur Verfügung:
Vutrisiran
Vutirisan verfolgt einen sehr spezifischen Therapieansatz. Small interfering RNA (siRNA), zu denen Vutrisiran zählt, besitzen eine Sequenz, die komplementär zu einem Teil der mRNA des Gens des Wildtyp- und des mutierten Transthyretin ist. Hierdurch erfolgt ein katalytischer Abbau der TTR-mRNA, was eine Verminderung der TTR -Spiegel im Serum zur Folge hat. Dieser katalytische Prozess findet in der Leber statt. Hierdurch lassen sich Proteinablagerungen in verschiedenen Geweben reduzieren.
- Die Applikation erfolgt subkutan alle 3 Monate.
Patisiran
Als siRNA verfolgt Patisiran den gleichen Wirkansatz wie Vutrisiran, muss allerdings häufiger appliziert werden und wird schlechter in der Leber aufgenommen. Zudem erfolgt die Gabe von Patisiran intravenös alle 3 Wochen.
Patisiran und Vutrisiran sind beide für ATTRv-Polyneuropathien im Stadium 1 und 2 zugelassen.
Tafamidis
Der TTR-Stabilisator Tamidis verhindert, dass die TTR-Tetramere zerfallen, was die im Verlauf entstehende abnorme Konfiguration und Aggregation der TTR-Monomere und letztlich Ablagerung von Amyloidfibrillen verhindert.
Tafamidis eignet sich zur Behandlung von Polyneuropathien Grad 1 oder 2.
Inotersen
Inotersen wirkt als Antisense-Oligonukleotid und bindet selektiv an mutierte und Wildtyp-TTR-mRNA, die dann enzymatisch mittels Ribonuklease H1 erkannt und abgebaut wird. Dadurch wird die Transthyretin-Bildung deutlich reduziert.
Inotersen ist ebenfalls in den Stadien 1 und 2 der ATTRv-Polyneuropathie zugelassen.
Weitere Wirkstoffe
Als weitere Wirkstoffe werden Diflunisal (zur Bindung von in der Leber gebildetem TTR) und Doxycyclin (zur Zerstörung der Fibrillen) meist in Kombination mit Tauroursodesoxycholsäure zur Behandlung der ATTRv-Polyneuropathie angewendet, wobei diese aufgrund der inzwischen deutlich effizienteren vorgenannten Wirkstoffe zunehmend seltener zum Einsatz kommen.
Durch die neuen therapeutischen Möglichkeiten ist es möglich, die ATTRv-Polyneuropathie effektiv zu behandeln, so dass letztlich die frühe Diagnosestellung den entscheidenden Faktor in der Behandlung darstellt.
Aus diesem Grund ist es wichtig bei Patienten mit einer Polyneuropathie, und insbesondere bei familiären Fällen, auf die Beteiligung anderer Organe zu achten.
Weitere Informationen zur Transthyretin-Amyloidose finden sich in unserem Neurologienetz-Online-Lehrbuch
Christine Thilmann | Neurologienetz.de